Das Adaptive Project beschäftigt sich immer wieder mit einer einfachen Frage:
Was wäre, wenn wir von Anfang an für Inklusion designen würden?
Marie-Laure erklärt, dass das Adaptive Projekt während der COVID-19-Pandemie begann, als Salomon von Hopper, einem führenden französischen Start-up, angesprochen wurde. Das Start-up stellt multifunktionale Prothesenblades aus recyceltem Kohlefaserabfall her und entwickelt innovative Prothesenlösungen aus Kohlefaser. Diese wird aus Airbus-A350-Flugzeugen recycelt. Auf der Suche nach langlebigen, leistungsstarken Sohlen, die mit ihren Blades kombiniert werden können, wandte sich Hopper an Salomon aufgrund ihrer Expertise in Schuhtechnologie und nachhaltigem Design.
Marie-Laure erläutert:
Barrierefreiheit stand im Mittelpunkt des Projekts. Sie habenProthesen, mit denen Menschen laufen können, entwickelt, aber ihnen hat noch das letzte Puzzlestück, die Sohle, gefehlt, damit alles funktioniert.
Was als Nischenkooperation begann, entwickelte sich schnell zu einer unternehmensweiten Initiative, die Abteilungen, Disziplinen und sogar ganze Branchen zusammenbrachte.
Marie-Laure fügt hinzu:
Es ging hier nicht darum, mehr Schuhe zu verkaufen, sondern darum, das Beste in Menschen freizusetzen und sie zu Gestalter*innen des Wandels zu machen. Und genau das ist der Grund, aus dem es Salomon gibt.
Boris Ghirardi, der 2019 bei einem Motorradunfall sein Bein verlor, brachte diese transformierende Botschaft eindrücklich auf den Punkt:
Ohne Sport war ich verloren. Sport war meine Therapie. Ich musste lernen, wieder zu gehen, dann zu laufen, dann Trailrunning zu machen. Sport hat mir meine Identität zurückgegeben.
Seine Geschichte wurde zu einem der realen Praxistests, die die Entwicklung der Blade entscheidend beeinflussten. Boris berichtet:
Als ich die erste Version getestet habe, sagte ich zu Patrick von Salomon: "Sorgt dafür, dass sie in den Bergen funktioniert." Und das haben sie getan. Als ich das Modell dann zum ersten Mal auf dem Trail genutzt habe, war es ein echtes Aha-Erlebnis. Ich habe gespürt, was wieder möglich ist.
Das Adaptive Project brachte intern ungeahnte Kooperationen ins Rollen. Patrick Leick, eine Schlüsselfigur bei Salomon mit langjähriger Erfahrung in der Athlet*innenbetreuung und Entwicklung innovativer Schuhlösungen, arbeitete erstmals eng mit einem Designer aus dem Wintersportbereich zusammen. Gemeinsam überlegten sie, wie barrierefreie Ausrüstung über den Footwear-Bereich hinausgehen kann.
Marie-Laure erzählt:
Selbst bei Salomon hatten sich Wintersport und Footwear bislang kaum berührt. Dieses Projekt zwang uns dazu, neue Gespräche zu führen und zwar zuerst innerhalb unserer eigenen Wände.
Das Ergebnis: ein neu entwickelter Snowboardboot für adaptive Athlet:innen. Technisch durchdacht, funktional – und visuell kaum von herkömmlichen Modellen zu unterscheiden.
Sie führt weiter aus:
Er sieht einfach aus wie ein normaler Boot. Eine unserer Athletinnen stand am Skilift, und jemand machte ihr ein Kompliment für den Schuh, ohne zu merken, dass er speziell für die Nutzung mit einer Prothese entworfen wurde. Solche Momente zeigen: Design verändert Wahrnehmung.
Design wurde so zu einem Werkzeug, um gesellschaftliche Bilder von Behinderung zu verändern. Weg von Einschränkung, hin zu Designpotenzial.
Boris ergänzt:
Die gesellschaftliche Ausgrenzung sinkt, wenn eine Prothese aussieht wie etwas, das jeder gerne tragen würde. Sie wird erstrebenswert, nicht medizinisch.
Erfahre mehr zu smarten Performanceanalysen, KI-gestützten Trainingssystemen, immersiven Fan-Erlebnisse, Retail-Tech-Innovationen und mehr auf der ISPO 2025.
So wegweisend Design und emotionale Wirkung des Adaptive Project auch waren, damit es wirklich skalierbar wird, musste vor allem die Preisfrage gelöst werden.
Boris erklärt:
Die erste Blade, die ich getestet habe, kostete 10.000 Euro. Das ist, als würde man in ein Schuhgeschäft gehen und ein Paar kostet plötzlich 10.000 Euro.
Durch die Partnerschaft zwischen Salomon, Hopper und Airbus konnte dieser Preis deutlich gesenkt werden, auf etwa 2.000 Euro. Ein großer Fortschritt. Doch das Ziel ist noch nicht erreicht.
Marie-Laure berichtet:
Wir sind noch nicht am Ende. Die nächste Phase heißt Skalierung: Wir wählen gezielt Projekte aus, die wir in den Markt bringen können, senken die Preise weiter und durchbrechen die Zugangsbarriere.
Für Boris ist Barrierefreiheit nicht nur eine Preisfrage, sondern auch eine strukturelle Herausforderung:
Wir brauchen Lösungen, die einfach zu nutzen und zum richtigen Preis verfügbar Zugänglichkeit. Salomon oder Hopper allein könnten das nicht stemmen. Aber gemeinsam haben wir bewiesen, dass es geht.
Und der Effekt geht weit über den finanziellen Aspekt hinaus. Boris ergänzt:
In meiner Non-Profit-Organisation Level Up haben wir Menschen mit diesen Blades auf 3.000 Meter hohe Gipfel gebracht. Einer sagte mir: "Wenn ich dich vor 20 Jahren getroffen hätte, wäre mein Leben anders verlaufen." Das werde ich nie vergessen.

Barrierefreiheit wird oft in technischen Kategorien gedacht. Doch was dieses Projekt besonders macht, ist der Fokus auf das emotionale und soziale Erlebnis. Für Marie-Laure stand von Anfang an fest: Es geht beim Design nicht nur um Funktion, sondern um Wahrnehmung.
Sie betont:
Wenn das Design überzeugt, tritt die Behinderung in den Hintergrund. Plötzlich sprechen die Leute über das Produkt – nicht über die Prothese. Und das verändert alles.
Eine Snowboarderin, die den adaptiven Boot nutzte, wurde wegen des eleganten Designs sogar für eine Profi-Athletin gehalten.
Marie-Laure erinnert sich:
Jemand meinte tatsächlich, er wünsche sich genau diesen Boot. Und sie antwortete: "Ich bin behindert, deshalb darf ich ihn tragen." Solche Momente zeigen, was gutes Design bewirken kann.
Auch Boris testete frühe Prototypen und war ehrlich:
Einige sahen einfach nur aus wie unfertige Modelle: unbequem, unansehnlich. Aber durch Salomons Designarbeit hören wir heute: "Den will ich auch." Und zwar auch von Leuten mit zwei Beinen.
Der große Auftritt kam in Paris bei den Paralympics. Dort präsentierte Salomon erstmals öffentlich drei Prototypen:
- Einen Snowboardboot mit adaptiven Funktionen
- Eine Trailrunning-Blade aus recyceltem Holz
- Einen Skitouren-Boot für adaptive Athlet:innen
Die Resonanz war direkt und deutlich. Maire-Laure berichtet:
So viele Menschen, darunter Athlet*innen, Medien und Konsument*innen, haben sich gemeldet, um die Produkte zu testen oder zu kaufen. Aber wir müssen die Erwartungen realistisch halten. Es sind Prototypen. Unser Ziel ist, sie zu perfektionieren, bevor wir sie auf den Markt bringen.
Der Fokus liegt jetzt auf Priorisierung: Welche Produkte lassen sich in Serie bringen? Wie schnell ist eine skalierbare Produktion möglich? Und wie bleiben die Preise bezahlbar?
Boris bringt es auf den Punkt:
Vor fünf Jahren war ich bei einem Trailrun der Einzige mit einer Blade. Heute habe ich zehn andere gesehen. Das ist Fortschritt. Das ist Hoffnung. Wir sind noch nicht am Ziel, aber die Tür steht offen.

In der Sportbranche gilt oft die Annahme: Innovation folgt dem Profit. Dieses Projekt zeigt: Purpose kann genauso stark wirken – mit ebenso hohem geschäftlichem Potenzial.
Marie-Laure formulierte es so:
Hier geht es nicht um Stückzahlen. Es geht um Relevanz. Wer Geschichten über Outdoor-Erlebnisse und Spitzenleistung erzählt, kann nicht 15 % der Bevölkerung außen vor lassen.
Zahlen unterstreichen ihre Haltung:
- 50 % aller Menschen erleben im Laufe ihres Lebens eine Form von Behinderung – temporär oder dauerhaft.
- Unternehmen, die in Purpose-getriebene Projekte investieren, sind laut Studien im Schnitt 35 % innovativer.
Sie betont:
Wir entwickeln hier keine Nischenlösung. Wir bauen den nächsten Markt. Und er ist längst da.
Auch Boris sieht Inklusion als nächste Stufe der Performance-Kultur:
In den letzten 40 Jahren hat sich das Bild von Frauen im Sport grundlegend verändert. Jetzt ist es Zeit, dasselbe für Athlet*innen mit Behinderung zu erreichen.
Während Salomon sich darauf vorbereitet, sein Angebot an adaptiver Ausrüstung zu skalieren, ist eines klar: Es handelt sich hier nicht nur um eine Produktlinie – es ist ein kultureller Wandel. In einer Welt, in der sich viele Jugendliche zu wenig bewegen Barrieren für Menschen mit Behinderung weiterhin bestehen, ist das Potenzial für Veränderung nicht nur groß, es ist notwendig. Marie-Laure weiß:
Es geht nicht nur um Athlet*innen wie Boris, es geht um die nächste Generation und die danach. Es geht darum, eine neue Erzählung zu schaffen: über Sport, Leistung und Teilhabe.
Für Markenverantwortliche, Produktentwickler*innen oder Marketingentscheider*innen bietet dieses Projekt mehr als Inspiration. Es zeigt, wie Innovation nachhaltig, skalierbar und gesellschaftlich wirksam werden kann. Boris fasst es in einem Satz zusammen:
Es ist unbezahlbar, jemanden zum ersten Mal wieder laufen zu sehen. Das ist der Spirit. Das ist die Zukunft des Sports.
Mehr smarte Technologien, die die Sportbranche vorantreiben wie smarte Performanceanalyse, KI-gestützte Trainingssysteme, immersive Fan-Erlebnisse, Retail-Tech-Innovationen und mehr gibt es bei Sports Brand Media auf der ISPO 2025. Die Konferenz findet am 01. und 02. DEZ. statt.
Für Produktverantwortliche, Markenmanager*innen, MarketingexperÜtinnen und Retailer:innen ist das Adaptive Project nicht nur eine inspirierende Geschichte. Es ist eine Vorlage für zukunftsfähige Produktentwicklung und Markenführung.
Die wichtigsten konkreten Learnings:
- Inklusion von Anfang an in die Förderung und Entwicklung integrieren: Barrierefreiheit nicht nachträglich einbauen, sondern als Ausgangspunkt nutzen.
- Branchenübergreifende Partnerschaften nutzen: Zusammenarbeit mit Luftfahrt, Start-ups und NGOs eröffnet neue Wege.
- Auf erstrebenswertes Design setzen: Produkte für Menschen mit Behinderung sollten schön, nicht klinisch wirken.
- Athlet*innen-Stimmen ins Produktdesign einbinden: Echte Nutzer*innen helfen, bessere Produkte zu entwickeln.
- Purpose als Treiber interner Zusammenarbeit einsetzen: Silos aufbrechen, indem man sich um eine gemeinsame Mission schart.
- Auf Skalierung vorbereiten und ehrlich zur Marktreife sein: Begeisterung entsteht schnell, Erwartungen sollten realistisch gesteuert werden.
- Den Business Case für Purpose im Blick behalten: Inklusion kann unerschlossene Märkte öffnen und langfristig Markenloyalität fördern.
 Sports BusinessWarum CEP den Running-Markt neu denkt
Sports BusinessWarum CEP den Running-Markt neu denkt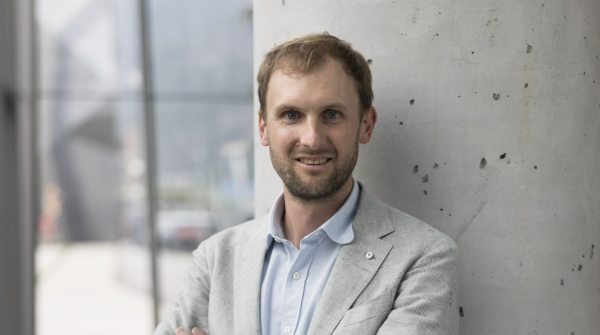
- ISPO Award
- Bergsport
- Bike
- ISPO Brandnew
- Design
- Retail
- Fitness
- Health
- ISPO Collaborators Club
- ISPO Beijing
- ISPO Job Market
- ISPO Munich
- ISPO Shanghai
- ISPO Textrends
- Running
- Brands
- Nachhaltigkeit
- Olympia
- Outdoor
- Promotion
- Sportbusiness
- Textrends
- Triathlon
- Wassersport
- Wintersport
- eSports
- SportsTech
- OutDoor by ISPO
- Heroes
- Sport Fashion
- Urban Culture
- Challenges of a CEO
- Messen
- Sports
- Find the Balance
- Produktreviews
- Magazin


